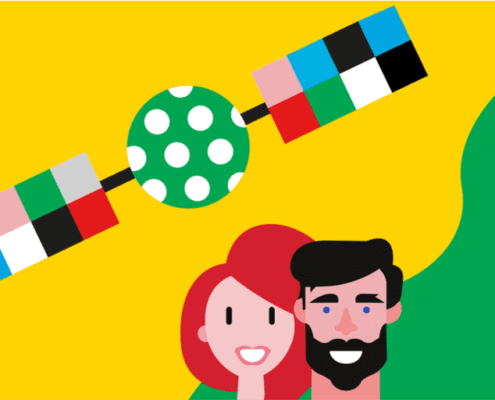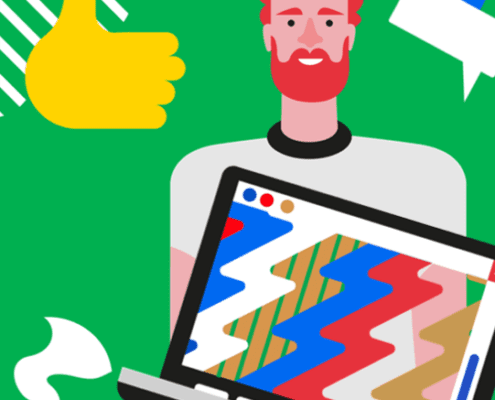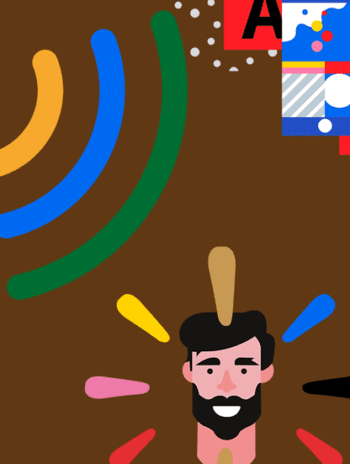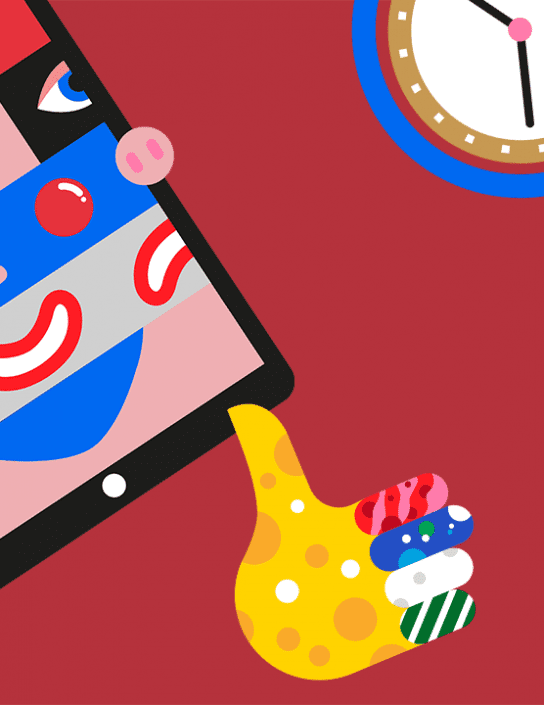Warum Terminologie wichtig ist
Seit Menschen miteinander kommunizieren, kommt es zu Missverständnissen. Diese können in manchen Teilbereichen des Lebens zu gefährlichen Situationen führen. So haben sich bereits in der Vergangenheit teilweise ganz eigene Terminologien gebildet, um der Unzulänglichkeit der Alltagssprache zu entgehen. Beispiele hierzu finden Sie weiter unten.
Eine genaue Terminologie ist auch im Unternehmensalltag von großer Bedeutung. Denn eine fehlende präzise und allgemein akzeptierte Bezeichnung für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung erschwert die Kommunikation mit Zulieferern, internen Stakeholdern und Kunden. Ungenaue oder unterschiedliche Bezeichnungen für dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung führen nicht selten zu Missverständnissen und Unsicherheit.
Eine einheitliche Corporate Language ist – ähnlich wie eine Corporate Identity – für die sprachliche Identität eines Unternehmens unerlässlich.
Ein sauberes Terminologiemanagement kann bereits bei der Produktentwicklung helfen, eine eindeutige Definition für ein Produkt oder den Teilbereich eines Produkts zu etablieren und dafür zu sorgen, dass diese in alle Marketingmaterialien sowie die interne Dokumentation einfließen kann. Für Unternehmen ist es daher essenziell, ein professionelles Terminologiemanagement zu implementieren.
Nur so kann man sicherstellen, dass alle Mitarbeiter dieselbe Sprache sprechen. Damit können Unternehmen ihren Kundenservice verbessern und mehr Kundenzufriedenheit schaffen – was letztlich das Wachstum des Unternehmens steigert. Daher ist es entscheidend für jedes Unternehmen, einen professionellen Terminologen als Teil des Teams an Bord zu haben – um den Erfolg seiner Projekte garantieren zu können und um Missverständnisse aufgrund sprachlicher Inkonsistenz oder falscher Ausdrucksweise auszuschließen. Indem Unternehmen professionelle Terminologien nutzen und einhalten, ermöglichen sie es ihren Teams, effektiv miteinander zusammenzuarbeiten.
Der Berufsstand des Terminologen
Terminologen sorgen dafür, dass die Bedeutung von Wörtern und Ausdrücken klar und präzise ist und im Idealfall mittels moderner Tools zentral für alle zugänglich ist. In einer globalisierten Welt, in der Menschen aus aller Herren Länder zusammenarbeiten, ist dies umso wichtiger.
Ohne eine klar definierte Terminologie in der Ausgangssprache multipliziert sich die Anzahl der unklaren Termini über alle Fremdsprachen hinweg. Eine unsaubere Terminologie hat also negative Auswirkungen auf alle Zielmärkte, sorgt für unnötige Verwirrung und Missverständnisse und kann damit sogar den Unternehmenserfolg schmälern.
Die Ausbildung zum Terminologen
Eine direkte Ausbildung zum Terminologen ist nicht der klassische Weg. Viele Terminologen sind eher in die Terminologie-Arbeit hineingewachsen. Meist geschieht das im Rahmen des Übersetzungs- oder Dolmetsch-Studiums. Einige Hochschulen bieten jedoch mittlerweile ergänzend ein Masterstudium der Terminologie an, an der TH Köln ist beispielsweise der Masterstudiengang “Terminologie und Sprachtechnologie” möglich.
Dieser Masterstudiengang richtet sich an AbsolventInnen des Bachelorstudiengangs “Mehrsprachige Kommunikation” am ITMK der TH Köln sowie AbsolventInnen weiterer, auch nicht-translatorischer Studiengänge anderer Hochschulen, die die für das Studium notwendigen Vorkenntnisse und Eignung mitbringen.
Terminologiemanagement ist Wissensmanagement
Jeder, der sich schon einmal mit Terminologiearbeit beschäftigt hat, weiß, wie frustrierend es ist, wenn die Früchte teilweise monatelanger Arbeit in einer Schublade oder einem Ordner verschwinden und niemand darauf zugreifen kann. Wer hier Abhilfe schaffen will, benötigt die richtigen Tools.
Idealerweise sind diese Tools zentral (d. h. online) verfügbar. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Stakeholder von der technischen Dokumentation über das Produktmanagement und -marketing bis zu den Sprachdienstleistern dieselbe Sprache sprechen – weltweit.
Dann lohnt sich Terminologiearbeit und kann in ihrer Gesamtheit genutzt werden. Wenn Fachvokabular, Kompetenzen und jahrelange Erfahrung und Fachwissen für alle im Unternehmen greifbar sind, zahlt sich die oft mit hohen Kosten verbundene Terminologiearbeit also nachhaltig aus.
Klare Terminologie, wenn es darauf ankommt
Eine saubere Terminologie kann in vielen Bereichen für Klarheit sorgen. Zum Beispiel: – In der Wissenschaft, um komplexe Sachverhalte verständlich zu machen – In der Politik, um kontrovers diskutierte Themen zu beschreiben – In der Wirtschaft, um Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten – In der Medizin, um Krankheiten und Behandlungen präzise zu beschreiben – In der Technik, um Geräte und Prozesse zu beschreiben – In der IT, um neue Software und Hardware zu beschreiben
Wenn es darauf ankommt, auch unter schwierigen Verhältnissen eindeutig zu kommunizieren, werden teils sogar völlig eigene Begriffe geschaffen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Bezeichnung der Seiten eines Schiffs. Rechts oder links hilft hier nicht weiter, weil die Person mit der man spricht (oder sich im Sturm zu verständigen versucht) eine andere Blickrichtung haben kann als man selbst. Hier sind Steuerbord und Backbord vollkommen eindeutig, egal in welche Richtung man gerade schaut.
Der Flugfunk geht sogar noch einen Schritt weiter. Die offizielle Sprache im internationalen Flugfunk ist Englisch. In den Anfängen der Fliegerei waren Sende- und Empfangsgeräte von ihrer Klangqualität noch deutlich schlechter. Daher galt es nicht nur möglichst kurze Ausdrucksweisen einheitlich zu schaffen, um die Überlastung der aktiven Frequenz zu vermeiden sondern diese mussten auch ein möglichst geringes Potenzial in sich bergen, missverstanden zu werden.
Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde das sogenannte “NATO-Alphabet” erschaffen. Um eine Flugzeug-Kennung wie z.B. “D-ECPT” über Funk so durchzugeben, dass diese zweifelsfrei verstanden werden kann, ist “De Eh Ce Pe Te” wenig tauglich. Alles klingt ähnlich und wenn es zusätzlich noch Nebengeräusche und Rauschen auf der Frequenz gibt, sind Missverständnisse vorprogrammiert. “Delta Echo Charlie Papa Tango” hingegen ist deutlich klarer.
Über die Zeit hat es auch Veränderungen im Flugfunk gegeben. Teilursache für einen tragischen Flugunfall auf Teneriffa war die Verwechselungsgefahr der Sprechgruppe “We are now at take-off” (“Wir befinden uns bereits im Startvorgang”) mit “We are ready for take-off” (“Wir sind abflugbereit”.). Dadurch kam es zu einem schwerwiegenden Missverständnis zwischen Pilot und Lotse, was zu einem katastrophalen Unfall führte. In der Folge kam es zu einer Änderung der offiziellen “Funkterminologie”.
Diese bewirkte, dass sich ein Flugzeug mit “Ready for departure” und NICHT “Ready for take-off” melden muss, wenn es abflugbereit an der Startbahn steht. Beides sind synonyme Begriffe, aber durch die Festlegung auf eine einheitliche Verwendung der Begrifflichkeiten und die Regeln für deren Verwendung wurde mehr Klarheit geschaffen und somit das Risiko eines weiteren fatalen Missverständnisses eliminiert.
Schlussüberlegungen
Die letzten Beispiele aus Seefahrt und Fliegerei sind möglicherweise sehr eindringlich, belegen aber den Wert unmissverständlicher Kommunikation und Benennung.
Unabhängig vom Fachgebiet, sei es in der technischen Dokumentation oder dem Marketing oder in völlig anderen Unternehmensbereichen, müssen sich Experten zuverlässig über ein Thema unterhalten können, und das sehr häufig über Sprachgrenzen hinweg. Hierzu müssen die Fachwörter eindeutig definiert sein.
Terminologen helfen uns dabei, die Welt ein wenig verständlicher zu machen und Missverständnisse zu vermeiden.